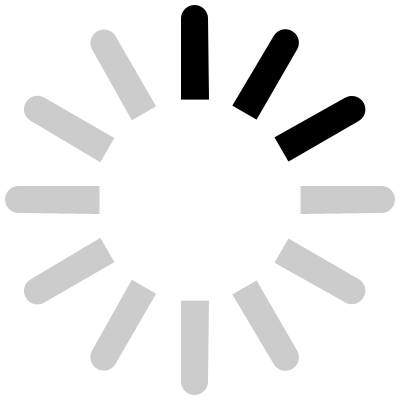08014 Schaffen von Resilienz durch eine kompetente Notfallorganisation am Beispiel des Industrieparks Höchst
|
Der Industriepark Höchst ist ein historisch gewachsener Industriestandort im Westen Frankfurts mit einer über 150-jährigen Geschichte. Er ist einer der größten Forschungs- und Produktionsstandorte der Chemie- und Pharmabranche in Europa. Auf einer durch den Main geteilten Gesamtfläche von 460 Hektar sind rund 90 Unternehmen in über 800 Pacht- und Mietgebäuden, 120 Produktionsanlagen sowie mehr als 80 Labor- und Bürogebäuden mit insgesamt rund 22.000 Mitarbeitern angesiedelt. Im Industriepark werden organische und anorganische Grund- und Feinchemikalien, Kunststoffe, Farbstoffe, Pflanzenschutzmittel sowie Medikamente, wie z. B. Insulin, hergestellt. von: |
Standortbetreiber ist die Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, die auch für die Notfallorganisation des gesamten Standorts verantwortlich ist, was privatrechtlich in einem Standortvertrag mit allen im Industriepark tätigen Unternehmen vereinbart ist. Dabei gilt nach Auffassung des Arbeitskreises „Industriepark” der Störfallkommission beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Übertragung von Gefahrenabwehr und Notfallorganisation auf eine Infrastrukturgesellschaft als Standortbetreiber als „Best Practice” [1].
Die Normalorganisationen der im Industriepark tätigen Unternehmen sind mit Aufbau- und Ablauforganisation darauf ausgerichtet, die Geschäftsprozesse ihrer Unternehmen, hier insbesondere die Produktion von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen oder unterstützenden Dienstleistungen, möglichst kosteneffizient auszuführen.
Ereignisse, wie z. B. schwere Unfälle, Brände, Explosionen, Stoffaustritte, Naturkatastrophen, Produktrückrufe, Bedrohungslagen, Störungen der Energieversorgung, Störungen der Abwasserreinigungsanlagen, sowie sonstige negative „Schlagzeilen” in den Medien haben im schlimmsten Fall gravierende Auswirkungen. Dabei können Personen, Umwelt, Anlagevermögen und Image einzelner Unternehmen oder des gesamten Industrieparks dauerhaft geschädigt werden. Um in Notfall- und Krisensituationen eine Eskalation zu vermeiden, ist die Handlungsfähigkeit der Gesamtorganisation kurzfristig unter enormem Zeitdruck wiederherzustellen.
1 Definition von „Resilienz” in Bezug auf die Notfallorganisation des Industrieparks Höchst
Bestandteil des oben erwähnten Standortvertrags ist als mitgeltende Unterlage ein Alarm- und Gefahrenabwehrorganisationshandbuch für den gesamten Industriepark.
Dieses Handbuch beschreibt den organisatorischen Rahmen und umfasst alle auf den Industriepark bezogenen Vereinbarungen des Alarm- und Gefahrenabwehrplans. Es regelt das Zusammenwirken der Einsatzeinheiten, legt die Kompetenzen des Einsatzstabs fest, beschreibt die Bereitschaftsdienste und enthält alle zur Gefahrenabwehr relevanten Unterlagen sowie die Beschreibung der internen und externen Alarmierungsmethoden. Die Anlagenbeschreibungen und die betrieblichen Abläufe für Ereignisfälle wiederum werden in betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrorganisationshandbüchern beschrieben, die von den Anlagenbetreibern in einem vorgegebenen Rahmen selbst erstellt und gepflegt werden.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Notfallorganisation des Industrieparks Höchst aufgestellt ist, um in Ereignisfällen „resilient” agieren zu können. Dies soll anhand der Definition von „Resilienz” des dänischen Psychologen Prof. Ph.D. Erik Hollnagel untersucht werden. Er definierte Resilienz als:
„Inhärente Fähigkeit eines Systems die Funktionsfähigkeit anzupassen, vor, während oder nach einer Störung oder einem Wandel, sodass die notwendigen Operationen erhalten bleiben unter erwarteten und unerwarteten Bedingungen. Dazu muss die Organisation in der Lage sein, zu reagieren, und zwar zeitnah und effektiv mit der Fähigkeit, das Richtige zu tun, die Durchführung und Entwicklung (prognostisch) zu beobachten, langfristig über Risikobetrachtung hinausgehend zu antizipieren und über Erfahrungssammeln zu lernen und ggf. das Verhalten entsprechend anzupassen.” [2]
Hollnagel stellt vertiefend die folgenden vier Fähigkeiten einer Organisation dar, die vorhanden sein müssen, um organisationale Resilienz zu ermöglichen [3]:
| 1. | Antizipieren (Anticipating): die Erstellung von Risikoanalysen und die Ableitung von Strategien zur Beherrschung dieser Risiken sowohl durch Konzepte für eine robuste Technik als auch das Vorhalten flexibler und widerstandsfähiger Teams |
| 2. | Beobachten (Monitoring): Überwachung von Systemen und Prozessen durch Technik und Menschen, Kommunikation bei Auffälligkeiten |
| 3. | Reagieren (Responding): Störungsbewältigung durch flexibles und schnelles Handeln und Antizipation möglicher Entwicklungen |
| 4. | Lernen (Learning): Lernen aus bewältigten Störungen, aber auch aus Anpassungen an veränderte Bedingungen. |
2 Notfallplanung und Antizipation von Ereignissen
Antizipieren bedeutet für den Industriepark, dass potenzielle Risiken bekannt, Ereignisabläufe im Vorfeld durchdacht und die erforderlichen Interventionskräfte mit der notwendigen technischen Ausstattung vorgehalten werden. Zusätzlich muss eine Notfall- und Krisenorganisation mit genau definierten Aufgaben, Befugnissen, Abläufen und Schnittstellen für eventuelle Notfälle jederzeit kurzfristig verfügbar sein. Alle Funktionen sind grundsätzlich mit gut ausgebildeten, gründlich eingewiesenen und regelmäßig trainierten Spezialisten besetzt.
Der Grundstock des resilienten Systems wird aber bereits bei den Betreibern der Chemieanlagen gelegt. Die vorhandenen Einrichtungen und die Technik sind auf den Zweck und die Bedingungen am Standort angepasst. Neben der Ausstattung der teilweise sehr komplexen Anlagen mit der notwendigen Sicherheitstechnik und hinreichend fachlich gut ausgebildetem Personal ist die Entwicklung einer ausgeprägten Sicherheitskultur erforderlich.
Die Betreiber der Anlagen haben Kenntnis über alle potenziellen Risiken, die von ihren Produktionsanlagen ausgehen. Dazu gibt es umfangreiche Planungs- und behördliche Genehmigungsverfahren, und es werden in Fachgremien intensive Sicherheitsgespräche geführt, in denen unter anderem die Auslegung der Sicherheitstechnik sowie organisatorische Maßnahmen festgeschrieben werden. Informationen über die Risiken der Anlagen werden an die Notfallorganisation weitergegeben. So ist die Werkfeuerwehr oft schon in der Frühphase der Planung neuer Anlagen eingebunden. Sie erstellt bzw. prüft die notwendigen Brandschutzkonzepte für die behördlichen Genehmigungsverfahren. Nach Inbetriebnahme der Anlagen führt die Werkfeuerwehr in regelmäßigen Abständen Gefahrenverhütungsschauen durch, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu überprüfen. Zusätzlich werden die Betriebsmannschaften auch von der Notfallorganisation periodisch geschult und erhalten dabei grundlegende Informationen über Sinn und Zweck der Notfallorganisation und deren Ziele. Alarmübungen mit der Notfallorganisation runden die Schulungen ab und verbessern die Zusammenarbeit im Ereignisfall. Ferner gibt es auf alle Betreiber im Industriepark abgestimmte Regelungen für besondere, gefahrgeneigte Tätigkeiten, wie z. B. das Einsteigen in Behälter, Schweißarbeiten in Chemieanlagen oder das Heben von Lasten über Rohrbrücken mit Gefahrstoffen, in die bei Bedarf die Notfallorganisation mit eingebunden ist.
Für den Ereignisfall wird vom Standortbetreiber eine Notfallorganisation mit zusätzlichen Ressourcen (z. B. Einsatzkräfte) und der Fähigkeit, schnell, flexibel und effektiv einzugreifen, zur Verfügung gestellt. Die Zusammensetzung ist auf den Bedarf des Industrieparks zugeschnitten. Werkfeuerwehr, Notfallmanager, Werkschutz, ärztlicher Notdienst, Umweltschutz, Sicherheitsingenieure und Krisenkommunikatoren werden bei Bedarf durch weitere kurzfristig verfügbare eigene Fachfunktionen sowie Polizei und öffentliche Feuerwehr unterstützt.
Um die vorgegebenen sehr kurzen Hilfsfristen von fünf Minuten für den durch einen Fluss in zwei Hälften geteilten Industriepark mit einer Ausdehnung von 4,6 Quadratkilometern erfüllen zu können, gibt es auf beiden Seiten des Flusses jeweils eine ständig mit einer genügenden Anzahl an Feuerwehrleuten besetzte Feuerwache. Von dort aus rücken im Alarmfall die insbesondere für Ereignisse in Chemieanlagen gut ausgebildeten, regelmäßig trainierten Einsatzeinheiten mit der erforderlichen Ausrüstung aus, um die Betriebsmannschaft vor Ort schnell und effektiv unterstützen zu können. Im Ereignisfall wird bei Bedarf vor Ort sofort eine technische Einsatzleitung aus mehreren unabhängigen und sich gegenseitig unterstützenden Funktionen gebildet. Zu ihr gehören, unter der Leitung des technischen Einsatzleiters der Werkfeuerwehr, Führungskräfte der betroffenen Betriebe, ein Notfallmanager, der Werkschutz, eine Umweltschutzfachkraft sowie der Rettungsdienst oder bei Bedarf ein Notarzt. Gegebenenfalls können weitere Personen von Fachabteilungen hinzugezogen werden.
3 Monitoring zur Entdeckung von Ereignissen
Das durch Hollnagel [3] beschriebene „Beobachten” erfolgt im Industriepark Höchst einerseits durch die Überwachung der Kanalausläufe in den benachbarten Fluss sowie der Zu- und Abläufe der Abwasserreinigungsanlage. Zusätzlich sind eine Vielzahl von automatischen Brandmeldern und einige Videoüberwachungsanlagen installiert. Andererseits werden Produktionsanlagen und -prozesse der Betriebe in den Messwarten überwacht, die über einen hohen Stand an Technik verfügen und mit gut ausgebildeten Mannschaften besetzt sind. Abweichungen vom Sollzustand werden durch aufgeschaltete Alarme in den Messwarten signalisiert. Produktionsabläufe sind in den Betriebsanweisungen festgelegt, die mittels regelmäßiger Schulungen der Betriebsmannschaft bekannt sind. Die Schulungen zielen auch auf die Erreichung einer hohen Sensibilität des Personals für das Erkennen und sofortige Melden von Auffälligkeiten oder Abweichungen ab. Zusätzlich zu den automatisierten Alarmen in den Messwarten können Unregelmäßigkeiten durch turnusmäßige Rundgänge in den Betrieben festgestellt werden. Um rechtzeitig reagieren zu können, werden die Betriebsmannschaften im Rahmen von vertiefenden Alarmschulungen und -übungen, die gemeinsam mit der Notfallorganisation durchgeführt werden, zu vorsorglichem Handeln und einer guten Meldekultur angeleitet.